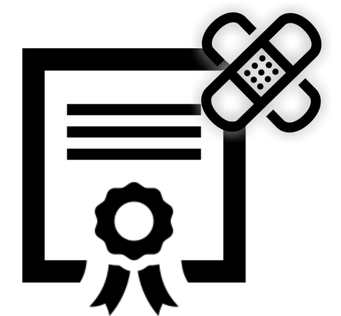
Ein gutes Gutachten – aber wie?
Eine öffentliche Bestellung bzw. Zertifizierung für Sachverständige ist kein Freifahrtschein – und was junge Sachverständige daraus lernen können: Dieses Urteil des Landgerichts Lüneburg (6 S 4/25) sorgt für Aufsehen: Das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wurde von den Richtern als „Kaffeesatzlesen“ bezeichnet – und damit als völlig ungeeignet für eine Entscheidungsfindung.
Dieses Urteil ist ein Weckruf. Nicht nur für Sachverständige, sondern auch für Juristen. Es wirft grundsätzliche Fragen auf: Was macht ein gutes Gutachten aus? Und woran erkennt man fundiertes Fachwissen?
Die Monstranz der öffentlichen Bestellung
In vielen Verfahren wird die öffentliche Bestellung und Vereidigung (öbuv) wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Damit wird Seriosität und Qualität signalisiert – und erzeugt oft einen sogenannten Halo-Effekt: Der Titel überstrahlt die tatsächliche fachliche Leistung. Doch wie das Urteil zeigt, schützt auch ein öbuv-Titel nicht vor methodischen Mängeln. Ein Gutachten ohne nachvollziehbare Daten, ohne Vergleichsmaßstäbe und ohne Einordnung in die Örtlichkeit, ist schlicht unbrauchbar – egal, wer es verfasst hat.
Hinzu kommt: Viele Sachverständige bewegen sich fachlich längst außerhalb jenes Bereichs, für den sie ursprünglich bestellt oder zertifiziert wurden. Das ist grundsätzlich erlaubt – wird aber problematisch, wenn dabei auf die ursprüngliche Qualifikation Bezug genommen wird, obwohl diese für das konkrete Thema nicht einschlägig, maßgebend oder relevant ist.
Gerichte trennen sich erfahrungsgemäß nur schwer von den von ihnen beauftragten Sachverständigen – selbst dann nicht, wenn diese offensichtlich für die gestellte Aufgabe nicht geeignet sind. Selbst wenn Sachverständige selbstkritisch einräumen, dass die geforderte Bewertung Neuland für sie ist, bleibt das Verfahren oft auf Kurs – mit allen Konsequenzen für die Qualität der Entscheidungsgrundlage.
Juristische Blindstellen: Wenn über etwas ganz anderes gesprochen wird
Die Kritik trifft aber nicht nur Sachverständige, auch Juristen – Richter wie Anwälte – urteilen regelmäßig über technische Sachverhalte, die sie nicht wirklich durchdringen. Wer als Zuhörer bei Gerichtsverhandlungen dabei ist, erlebt oft eine surreale Situation: Es wird über etwas ganz anderes gesprochen als das, worum es eigentlich geht.
Technische Details werden vereinfacht, missverstanden oder ignoriert; häufig ist da dann auch die Aufgabenstellung unklar oder schwammig formuliert. Fragen des Gerichts oder der Anwälte führen dann zu Nachbearbeitungen – nicht selten mit fragwürdiger Ergebnisqualität. Die Verantwortung für die fachliche Substanz wird dabei oft auf die Sachverständigen abgeschoben – ohne dass seitens der Justiz die Voraussetzung geschaffen wurde, um Qualität überhaupt einfordern zu können.
Technik für Juristen? Fehlanzeige.
Es gibt Angebote, die genau hier ansetzen: Seminare wie „Bautechnik für Nichttechniker“ des Berliner Schadenseminars oder anderer Anbieter richten sich an Kaufleute, Versicherer – und auch an Juristen. Doch Letztere sind dort selten anzutreffen. Dabei wäre genau das notwendig: ein Grundverständnis für technische Zusammenhänge, um Gutachten besser einordnen, verstehen und bewerten zu können. Denn nur wer die Sprache und Notation der Technik zumindest ansatzweise beherrscht, kann auch die richtigen Fragen stellen – und die richtigen Schlüsse ziehen.
Fachwissen sichtbar machen – nicht verstecken
Was ist faktisches Wissen, woran erkennt man Fachwissen? Sicher nicht allein an Bestellungen oder an Zertifizierungen. Auftraggeber – ob Gerichte, Versicherungen oder Privatpersonen – sollten genauer hinschauen und Folgendes beachten:
- Gibt es relevante Veröffentlichungen?
- Wo wurden Vorträge gehalten?
- Wie ist die Präsenz in der Fachöffentlichkeit?
Diese Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck. Vielmehr ist sie ein Zeichen dafür, dass sich jemand mit seinem Fachgebiet aktiv auseinandersetzt, diskutiert, streitet – und auch bereit ist, sich der Kritik zu stellen. Doch genau hier liegt ein weiteres Problem: Veranstalter von Fachtagungen berichten regelmäßig, wie schwer es ist, qualifizierte Redner für Fachvorträge zu gewinnen. Viele Sachverständige scheuen die Selbstdarstellung auf solchen Bühnen – und damit die öffentliche Auseinandersetzung.
Dabei wäre genau das notwendig. Denn: Die meisten Gutachten verschwinden in Aktenordnern oder Gerichtsakten. Sie sind nicht öffentlich zugänglich. Wer sich also ein Bild von der Qualifikation eines Sachverständigen machen will, muss auf andere Quellen zurückgreifen – etwa auf Rednerlisten von Fachveranstaltungen oder Autorenverzeichnisse in Fachzeitschriften.
Ein weiteres Hindernis: Viele Sachverständige bevorzugen eine introvertierte Arbeitsweise. Schon die Einführung eines Vier-Augen-Prinzips bei der Gutachtenerstellung könnte helfen, Qualität zu sichern und blinde Flecken zu vermeiden.
Wenn Zertifizierer und Anwälte aneinander geraten
Ein Nebenaspekt, jedoch durchaus aufschlussreich: Zertifizierungsstellen, die Sachverständigen wegen wiederholter Fortbildungsverweigerung die Zertifizierung entziehen, erhalten nicht selten Post von Rechtsanwälten – ausgerechnet von denen, die sich sonst über mangelhafte Gutachten beklagen. Ein Widerspruch, der zeigt, welche Unklarheit über die Bedeutung und Grenzen von Zertifizierungen herrscht – und wie stark formale Titel noch immer überbewertet werden.
Ein Aufruf an angehende Sachverständige
Deshalb: Zeigt euch! Wartet nicht darauf, dass euch jemand „bestellt“. Nutzt Fachzeitschriften, Blogs, LinkedIn, Seminare. Schreibt, diskutiert, widersprecht. Fachliche Sichtbarkeit ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit – gerade in einer Zeit, in der Vertrauen in Expertise nicht mehr selbstverständlich ist:
- Ein Gutachten ist kein Feigenblatt.
- Es muss nachvollziehbar, methodisch sauber und transparent sein.
- Und das beginnt nicht mit einem Titel – sondern mit Haltung.
- 1.8.2025: Leichte textliche Veränderungen

Kommentar schreiben
Dr. Peter Meier (Dienstag, 02 September 2025 11:48)
Es ist wie allerorten und allerzeiten. Wahrnehmung des Subjekts schlägt Wahrheit des Objekts.
Das Subjekt im Sinne seiner Wahrnehmung „bearbeiten“ ist zunehmend wichtiger als das Objekt im Sinne seiner „Wahrheit“ zu erarbeiten.
„Framing“ und „Nudging“ sind die Methoden der Beeinflussung der „Wahrnehmung“ des Subjekts als Ziel-„Person“.
Wie gelangen wir zur Wahrheit? Es ist im Beitrag angedeutet: Mit sachlicher Sprache, mit Trtansparenz, mit nachvollziehbarer Logik, mit Rationalität. Aber wo bleibt die Emotionalität? Hat sie gar in diesen Bereichen nichts zu suchen, weil sie dort nichts verloren hat?